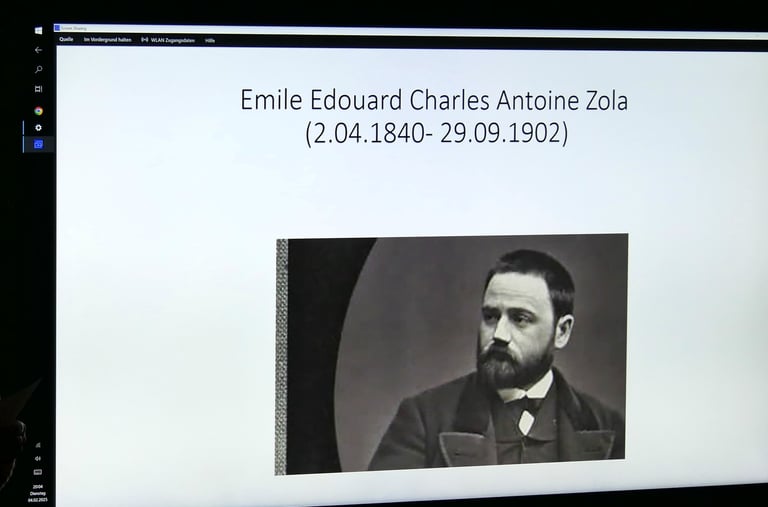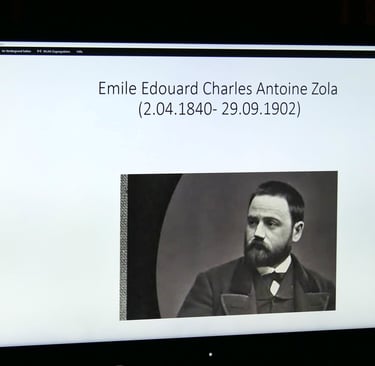Di., 04.02., 19.30 Uhr, Kolping-Forum
Emile Zola - Der öffentliche Ankläger
Zum 185. Geburtstag von Emile Zola präsentierte die DFG einen hochinteressanten Vortrag der Referentin Suzanne Bohn, die bereits zum 3. Mal in Paderborn bei der DFG zu Gast ist.
Emile Zola wird 1840 geboren und stirbt unter unklaren Umständen 1902, im Alter von nur 62 Jahren. Er gilt als Ankläger seiner Zeit und kritisiert den Kapitalismus und die Korruption.
Er kommt aus einfachen Verhältnissen und lebt zunächst mit seinen Eltern in Aix-en-Provence, wo er eng mit dem Künstler Paul Cézanne befreundet ist. Der Umzug nach Paris ändert viel. Er geht zwar in eine renommierte Schule, wird aber wegen eines Sprachfehlers und seiner provinziellen Herkunft gehänselt. Als 22Jähriger beginnt er als Bücherpacker bei dem Verlag Hachette und absolviert dort eine Ausbildung als Journalist. Schnell lernt er, dass es – wenn man weiterkommen will – auf Beziehungen und die Kunst der Vermarktung ankommt. So macht er Karriere bei Hachette. Cézanne und andere Freunde kommen nach Paris. Zola wird zur kulturellen Instanz, zum Sprachrohr der Pariser Künstlerszene. Seine Stimme zählt! Mit seiner scharfen Zunge wird er zum geachteten, aber auch gefürchteten Kritiker. Er wird Berichterstatter der Pariser ‚Salons‘.
1870 heiratet er Gabrielle Meley, die ihren Namen zu Alexandrine Zola ändert. Er beginnt seine ersten Romane zu schreiben. Sein Credo: Der Mensch ist ein Gefangener seines Milieus und seines Temperaments, seiner Gene. Er will von der breiten Masse für die breite Masse schreiben. Als Pazifist und Demokrat möchte er ein Pendant zu Balzacs „Menschliche(r) Komödie“ schreiben. Anhand einer französischen Familie und deren Mitglieder stellt er den Einfluss von Genetik und Milieu dar. Schließlich entsteht so das 20bändige Werk „Les Rougon-Macquart“, in dem 1200 erfundene Figuren vorkommen.
Zola konstruiert und plant seine Romane. Fast 20 Jahre lang isoliert er sich von der Außenwelt, um schreiben zu können.
Politisch sieht er sich als Sozialist, möchte aber keine Gleichmachung innerhalb der Gesellschaft und vermutet dahinter nur den Neid auf besser Gestellte. Es entstehen die berühmten Werke, wie „Nana“, „Germinal“, „La Terre“ und „La bête humaine“. Einige dieser Romane werden später verfilmt. Mit seinen Texten provoziert er und löst Skandale aus. Im Laufe der Zeit schwächen sie ihn, so dass er Panikattacken und Depressionen erleidet.
Er lebt mit seiner Frau einsam in ihrer Villa Médan. Die Ehe bleibt kinderlos. Schließlich verliebt er sich in eine junge Frau, mit der er zwei Kinder hat und ein Doppelleben führt. Alexandrine Zola bleibt seine Frau und lernt später sogar seine Kinder kennen. Sie erlaubt, dass sie nach Zolas Tod seinen Namen tragen.
Am Ende seines Lebens bewegt ihn v.a. die sog. Dreyfuss-Affäre und sein Text „J’accuse“ im Figaro im Jahr 1897. Er verteidigt den wegen Hochverrats verhafteten und auf die Teufelsinsel In Guyane deportierten Dreyfuss. Das angebliche Belastungsmaterial – so weiß man heute – existierte nicht. Zola gilt nun als gefährlicher Anarchist und geht für 11 Monate ins Exil nach England. Bei seiner Rückkehr wird er als Verräter verurteilt, dann begnadigt. Er ist ein gebrochener Mann und stirbt unter unklaren Umständen an einer Kohlenmonoxidvergiftung in seiner Wohnung.
Am 4. Juni 1908 wird er neben anderen berühmten Persönlichkeiten im Panthéon beigesetzt.
Gut eineinhalb Stunden gelingt es Suzanne Bohn ihre Zuhörerschaft im voll besetzten Saal des Kolping-Forums in ihren Bann zu ziehen. Ein spannendes Leben, spannend erzählt.